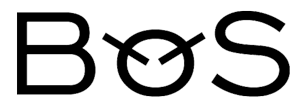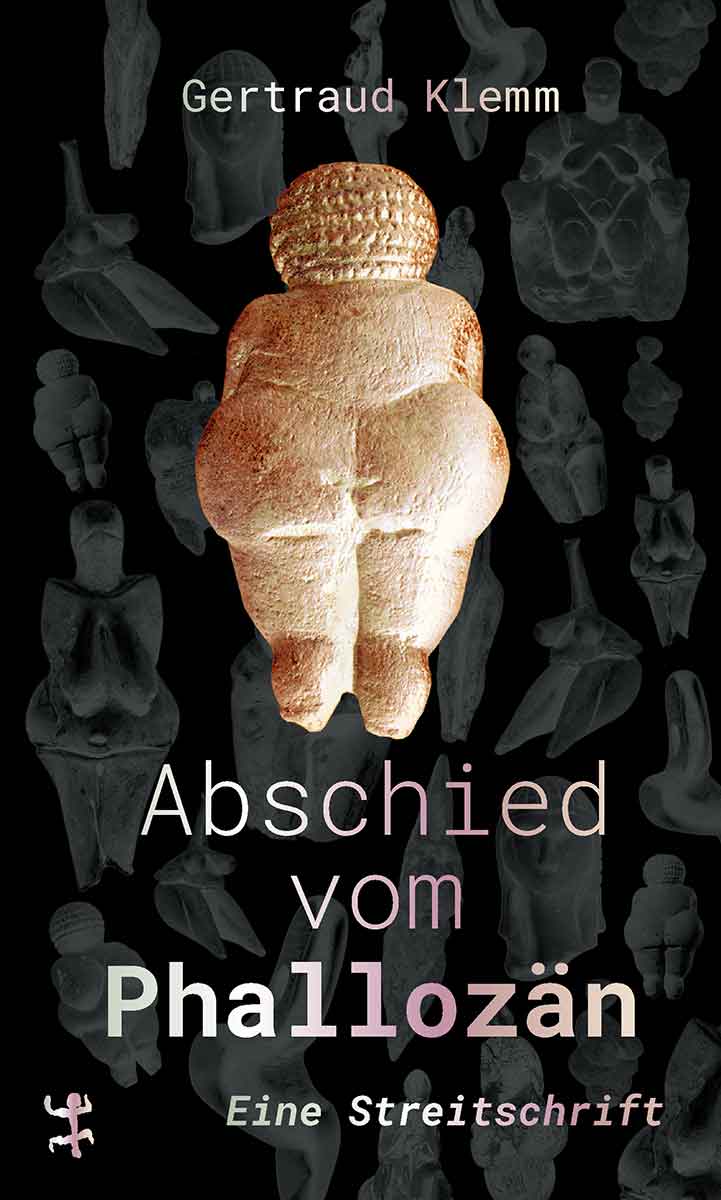Abschied vom Phallozän – Gertraud Klemm
Eine Rezension von Roswitha Perfahl
Gertraud Klemms scharfe Patriarchatskritik „Abschied vom Phallozän“ ist eine Streitschrift und kein ausführliches Sachbuch. Seit den 1990er Jahren erfolgt ein patriarchaler Backlash, der Frauen zwingt, einmal mehr ihre erkämpften Rechte wieder zu verteidigen. Hinter Kapitalismus, Neoliberalismus, Kolonialismus, Imperialismus und Rassismus steckt als Endgegner das Patriachat. Eine Gewaltherrschaft weniger Männer, so Klemm.
Die Autorin beklagt den Mangel an solidarischem Handeln, die Aufsplitterung des Feminismus in zahlreiche Lager, die durch „kannibalistische Tendenzen“ auffalle. In einem eigenen Kapitel übt sie Religionskritik, da derzeit keine Religion existiere die nicht zutiefst frauenfeindlich und patriarchal ist. Jedoch ist die Autorin weit davon entfernt, Spiritualität an sich gänzlich abzulehnen. Auch ein weiteres Werkzeug der Welterklärung, die Philosophie, wird, da Frauen bereits früh aus ihrer Geschichte hinausgeschrieben bzw. ihnen Definitionsmacht verwehrt wurde, als patriarchales Machtmittel entlarvt. Die Autorin thematisiert, wie viele Formen von Misogynie im Vergleich mit anderen Diskriminierungsformen noch akzeptiert sind.
Nicht das Anthropozän habe die Welt auf dem Gewissen, sondern das „Phallozän“, ein Begriff, der in „verschiedenen Sprachen für unterschiedliche destruktive Ausprägungen des Patriarchats benutzt [wird]; ich möchte mit ihm das Zeitalter eines völlig aus dem Ruder gelaufenen Patriarchats verbildlichen, das sich an die Schaltstelle aller Mächte katapultiert hat und von dort aus seine zerstörerische Kraft ausübt.“ (S.12)
Klemm bleibt nicht bei der Bestandsaufnahme der traurigen Gegenwart, wo patriarchale Klischees im neuen Tech-Gewand zelebriert werden, sondern schlägt vor, sich die Funktionsweise von Matriarchaten anzusehen, die, muss ergänzt werden, in ihrer heutigen Form von patriarchalen Strukturen durchzogen sind, da auch sie, wie alle Kulturformen einem historischen Wandel unterliegen. Mit ungläubigem Staunen lese ich, dass die Matriarchatsforschung, die ich seit meinem feministischen Erwachen im vorigen Jahrhundert kenne, an Generationen von Frauen vorbeigegangen sei. Wurde diese Forschung von der Mainstreamwissenschaft so umfassend unterdrückt, oder haben immer wieder Frauen selbst geglaubt, der Feminismus sei obsolet und sie bräuchten ihn nicht mehr? So wurde die Matriarchatsforschung in eine esoterische Schmuddelecke abgedrängt.
Klemm fordert nicht nur die neuerliche, intensive wissenschaftliche Beschäftigung mit matriarchalen gesellschaftlichen Organisationsformen, sondern erzählt auch von rezenten Versuchen sich matriarchal zu organisieren, an einem Beispiel aus Südamerika (Nashira, Cali, Kolumbien) zeigt. Matriarchate seien keine umgekehrten Patriarchate, keine Frauengewaltherrschaft, wie sie von Männern in verschiedenen Epochen als Warnung fantasiert wurden, sondern durch Gewaltlosigkeit, Egalität und konsensuale Entscheidungsfindung geprägt.
Zwei kritische Anmerkung seien erlaubt: Irritierend ist erstens, dass Klemm das Patriarchat nur auf die westliche Welt und deren Kolonialgeschichte bezieht. Der Text suggeriert, von Kolonialismus, Imperialismus und Rassismus ausgehend, dass Europa für die Verbreitung des Patriarchats verantwortlich sei. Aber das Patriarchat ist keine Erfindung Europas oder „der Weißen“, was angesichts des im Text angegebenen Alters dieser Herrschaftsform von 5000 Jahren ein Widerspruch wäre. Eine globale Herangehensweise wäre logisch und sinnvoller gewesen, und findet sich abseits der immer wieder betonten Engführung auf Europa da und dort im Text.
Großreiche, die alles schluckten, was schwächer war, gab es immer reichlich. Und dem Absatz über die Reconquista könnte man die vorher erfolgte Eroberung entgegenstellen und den damit verbundenen Rückzug in frühchristliche Flucht- und Wehrkirchen in den Pyrenäen. Es ist wohl eine Verirrung, den einen Eroberungskrieg als friedlicher als den anderen Verteidigungskrieg darzustellen. Sowie auch die Rolle der mitwirkenden arabischen und afrikanischen Sklavenhändler unter den Tisch gekehrt wird, die jene weißen Kolonisatoren mit reichlich „Material“ versorgten. Der Reichtum einiger afrikanischer Königreiche (Dahomey, Benin) ging auf Sklaverei zurück, was nicht immer thematisiert wird. Gelten patriarchale Imperien als wenige schlimm, wenn sie nicht europäisch waren?
Auch würde ich es zweitens als Fehlschluss bezeichnen, dass Sklaverei, Kolonialismus usw. als Folge von Humanismus und Aufklärung stattfanden, zumindest entsteht beim Lesen dieser Eindruck. Die Autorin schreibt von „humanistischer Pleite“, „historischer und humanistischer Schädlichkeit“ (S.8, 44–47), „globalem, humanistischem Totalversagen“ (60, 101). Vielmehr entstanden diese Denkrichtungen als Reaktion auf Gewaltherrschaften und trotz derselben. Folgerichtig bezogen und beziehen sich noch heute diskriminierte Gruppen auf die Errungenschaften der Aufklärung, wie Menschenrechte und Demokratisierungsprozesse, um ihre Gleichberechtigung durchzusetzen: Von Juden/Jüdinnen, den sich entwickelnden Nationalitäten, ArbeiterInnen im 19. Jahrhundert… bis zu den Frauen.
Ein solcher Fehlschluss verleitet übrigens dazu, Aufklärung, Menschenrechte und damit auch Demokratie und Frauenrechte als ‚weiß‘, ‚westlich dekadent‘ und daher ‚kolonialistisch‘ zu denken und alte patriarchale Gewaltstrukturen als schützenswerte „nichtwestliche Traditionen“ zu legitimieren.
Da das Patriachat die ganze Welt überzieht, bleibt zu hoffen, dass die Streitschrift „Abschied vom Phallozän“ als Text mit globalem und universellem Anspruch gelesen wird. In weiten Teilen der Welt sind Frauen noch weit entfernt von rudimentärer Gleichstellung, und in der sogenannten westlichen Welt wird mit aller Macht ein verheerender Backlash betrieben. Gertraud Klemms Text erinnert, schreckt auf und demonstriert, wie schnell Frauen wieder unter die patriarchalen Räder kommen können, und dass einmal erlangte Rechte immer wieder erkämpft werden müssen. Eigentlich ist es zum Verzweifeln!
Also wieder von vorne beginnen, zurück zum Anfang, auf Null? Ja, schreibt Gertraud Klemm, wir müssen wieder „feministische Drecksarbeit“ leisten. (S.123)
Zu hoffen bleibt, dass der Text Anlass liefert für ausgiebige Diskussionen auf breiter Basis, die den Diskurs und somit die Realität endlich weg vom Phallozän verschieben. Es wäre Zeit für eine fundamentale Wende in der Menschheitsgeschichte. So wie akzeptiert werden musste, dass die Sonne nicht um die Erde kreist, so kreist die Welt nicht um den Mann.
Roswitha Perfahl, August 2025
Für die Rezensionen sind die jeweiligen Verfasser:innen verantwortlich.
Gertraud Klemm: Abschied vom Phallozän: Eine Streitschrift
Berlin: Matthes & Seitz 2025
144 Seiten
20 EURO
ISBN 3751820876, 9783751820875