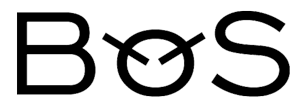Gesammelt 1
Texte von Gudrun Kapeller aus der Schreibpädagogik-Lehrgangsklasse 2020/2021
Die Nachbarin
Durch das Loch im Fliegengitter kann man das Haus der Nachbarin sehen. Manchmal sieht man auch die Nachbarin selbst, wenn sie im Frühling im Garten Blumen anpflanzt, im Sommer dösend auf dem wackeligen grünen Gartensessel sitzt oder im Herbst Laub auftürmt. Nur im Winter sieht man sie kaum. Die Nachbarin baut keine Schneemänner. Sie macht keine Schneeballschlachten. Sie lässt den Schnee einfach liegen. Ihr Garten glitzert im Winter wie ein weißes Meer bei Sonnenuntergang. Es ist ein Schneemeerglitzergarten. Durch das Loch im Fliegengitter sieht man nur eine winzige kleine weiße Welle davon. Vielleicht hätte ich es größer schneiden sollen, um besser versinken zu können.
Das Loch im Fliegengitter gibt es erst, seit ein Vogel es dort hineingepickt hat. Er hat mir die Sicht freigepickt.
Dort, wo früher das Blumenbeet der Nachbarin war, steht jetzt ein Trampolin. Um das Kreischen der Kinder mitzubekommen, braucht man kein Loch im Fliegengitter. Funktionierende Ohren reichen. Und selbst die Ohren von Opa hören das Hüpfen der Kinder. Aber er kann es ausschalten, wenn es zu laut wird.
Ich frage mich ständig, welcher Vogel so dumm sein konnte, statt des Meisenknödels das Fliegengitter zu zerpicken. Vielleicht war es einfach keine Meise.
Die Nachbarin streichelt über das Fell des kleinen Hasen. Ihre Finger sind runzelig. Sie war immer schon alt. Ich halte den Hasen ganz vorsichtig über den Zaun. Es ist der weiße mit den braunen Ohren und der braunen Nase. Er hat noch keinen Namen. „Weißt du“, sage ich zur Nachbarin, „du kannst ihn haben, wenn du möchtest, aber er muss weiter bei uns bleiben, weil du ja keine anderen Hasen hast.“ Die Nachbarin lacht und ich erschrecke mich vor dem Klang ihrer Stimme, weil ich sie noch nie gehört habe. Das Häschen fällt mir aus den Händen und landet weich in einem Laubhaufen im Garten der Nachbarin.
Ich darf das Fenster nur öffnen, weil das Fliegengitter davor angebracht ist. Durch das freigepickte Loch kann ich unmöglich fallen. Man kann nicht einmal etwas hindurchwerfen, außer einen Blick.
Die Kinder bauen mitten im Garten eine Höhle. Ein Ende des Leintuchs knoten sie um einen Baumstamm, das andere um das Bein eines grünen Gartensessels. Der Wind durchkreuzt die Baupläne der Kinder. Er wirft den Sessel um. Die Höhle wäre weniger einsturzgefährdet, würde die Nachbarin noch auf ihm sitzen.
Dieser Text ist im Workshop „Inspiration und Recherche“ mit Bettina Balàka entstanden.
Mondwind und Sommerregen
Mondwind und Sommerregen,
nachts, wenn die Welt für gewöhnlich schläft und ruht,
tut sich mein Gedankenkarussell auf,
bringt mich um den Schlaf,
raubt mir den Atem,
ich kann zwar atmen,
aber die Luft reicht nicht.
Nicht für mich,
vielleicht für dich,
aber du atmest andere Luft,
wir teilen unsere Luft nicht mehr.
Ich höre den Mondwind,
winde mich selbst
im Bett hin und her und um mein Selbst.
Ich suche die Verbindungen, doch der Wind trägt sie davon,
weg von mir,
weg von hier,
sie verblassen,
verblasen sich am Weg zum Mond
und retour von dort, wo sie hergekommen sind
und wo sie sich archiviert fühlen ohne jemals ganz weg zu sein.
Denn es sind Mondwinderinnerungen
an dich und mich, an uns.
In Zeiten, in denen es uns nicht mehr als uns gibt,
nur mehr als dich und mich.
Wenn mich dann der Tag empfängt, kann ich ihn oft nicht sehen,
er verliert sich im Geäst an Gedanken.
Selbst dem Sommerregen gelingt das Reinwaschen nicht,
wie soll ich also reinwachsen in diesen neuen Tag?
Tanzen im Sommerregen bringt mir nichts,
vor allem nicht dich zurück
oder mich dahin, wo du jetzt deine Luft atmest,
vielleicht jemand anderem den Atem raubst
mit deiner Art, luftleeren Dingen Leben einzuhauchen und gemeinsam durchs erschaffene Leben zu gehen,
bis der Weg an ein Ende führt, das man zuvor nicht sehen konnte.
Es ist der Sommerregen, der diesen Weg überspült
und alles wegspült, was wir gegangen sind,
es gibt also das Zurück nicht mehr, denn es gibt den Weg nicht mehr.
Ich habe vertraut,
gebaut,
verstaut,
geschaut.
In mich.
Ganz tief hinein.
Dort hinunter,
wo Mondwind und Sommerregen liegen.
Umschlungen,
verschlungen,
doch jeder mit sich allein,
bis jemand kommt,
der ihnen wieder zueinanderhelfen wird.
Dieser Text ist im Workshop „Schreiben in Zeiten des Umbruchs“ mit Claudia Dabringer entstanden.