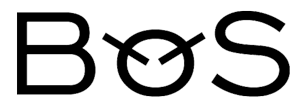Gesammelt 2
Texte von Gudrun Kapeller aus der Schreibpädagogik-Lehrgangsklasse 2020/2021
Damals und heute
Ein Altbau unter vielen in einer Großstadt. Noch nicht saniert. Einfach ein Altbau, wie man Altbauten kennt. Altbau im Außen, Altbau im Innen. Nur die Bewohner sind neu und sich fremd. Anonymität steht auf den Schwarzen Brettern und Anschlagstafeln in den Eingangsbereichen, Türschilder ohne Namen, Top-Nummern als Versuch, den Datenschutz zu wahren. Aber: Kleine Balkone als Fenster zum Draußen. Und sie steht auf ihrem. Es ist ihr Fenster zu einem kleinen bisschen Welt.
Abends zieht es sie dorthin, ins Draußen. Links und rechts von ihr andere Welten und andere Leben. Der Neubau auf der einen Seite steht fast leer. Wenig Leben, aber das zumindest in einem gewissen Luxus. Luxus, den sie nie hatte und auch nie gebraucht hat. Alltag und Alltägliches. Mehr will sie nicht. Blumen. Sonne. Zuhause. Essen. Von allem gerade so viel, dass es noch tragbar und erträglich ist. Margariten statt Orchideen. Frühling statt Sommer. 40 Quadratmeter statt 120. Kartoffeln statt Filet.
Wenn im Sommer die Tage länger werden, obwohl es schon Abend ist, fängt sie an zu beobachten. Ein einfacher, bescheidener Zeitvertreib, zu dem man niemanden braucht, außer sich selbst und davon hat sie genug. Sie beobachtet, was hier geschieht und dort passiert. Sie mischt sich nicht ein. Sie bleibt still, aber nicht heimlich. Einmischen wäre zu kompliziert, wo sie es doch einfach mag. Trotzdem: Manches hätte es früher so nicht gegeben. Aber weil es das jetzt gibt, erlaubt sie sich das kleine Stück Welt um sie herum.
Von dort hört sie Worte, die niemand hören möchte. Von da dringt Kindheit an ihre Ohren. Sie ist sich in diesem Moment nicht sicher, was mehr schmerzt. Sie sieht der Sonne nach und sehnt sich nach etwas, von dem sie vielleicht gar nicht weiß, dass sie es jemals vermisst hat. Sie hat ja alles. Eigentlich.
Regen, denkt sie. Es sollte wieder einmal Regen geben. Luft waschen, Blumen gießen, Welt tränken. Wäre die Welt bunter, wenn der Regen den Schleier des Banalen verschwinden ließe? Der Staub bliebe trotzdem im Inneren. Das Innere kann man nicht säubern lassen, man muss es selbst putzen, wenn man es will.
Gedankenwechsel in den Innenhof. Die Kinder spielen. Es sind immer die Kinder, die man sieht, nie die Mütter und schon gar nicht die Väter. Das hat sich nicht verändert. Sie kennt es selbst so. Die Mutter im Haus, der Vater außer Haus. Die Kinder draußen in die Welt gesetzt. Aber es werden weniger. Dafür werden sie lauter. Manchmal stört sie das, heute noch nicht.
Die Kinder spielen Fußball. Die meisten, nicht alle. Fußball als Zeitvertreib, der nie aus der Mode kommt. Sie hat nie Fußball gespielt. Das, was sie gespielt hat, kennt man heutzutage nicht mehr. Das, womit sie gespielt hat, gibt es vielleicht noch, aber haben will es niemand mehr. Technik dominiert die Welt, wenn auch gerade nicht diesen einen Innenhof und das freut sie ein bisschen, Sie lächelt. Eigentlich viel zu selten.
Sie spürt den Abend, aber die Strickjacke hält ihn noch fern.
Dieser Text ist im Rahmen der Aufgabenstellung zum Abschluss des Lehrgangs „Schreibpädagogik“ entstanden.
Wohnzimmer
Das Wohnzimmer ist der größte Raum im Haus. Als würden die Zimmer immer kleiner werden, je weiter man im Haus nach hinten geht. Man kann durch die offenen Schiebetüren durch Esszimmer und Küche im Kreis laufen und landet doch immer wieder im Wohnzimmer.
Mama diskutiert mit Papa, wo das Bild hängen soll. Das neue Bild für das neue Wohnzimmer. Es passt genauso wenig in den Raum wie die neue Couch. Die alte, abgewetzte war gemütlicher. Man musste auf nichts aufpassen, weil es eh schon egal war. Kaputter konnte nichts mehr werden. Jetzt dürfen wir die Gläser nur mehr auf Untersetzer auf den Tisch stellen. Auf den neuen Tisch. Oder auf eine der Zeitungen.Eine vom Stapel der Vorwoche natürlich. Nichts ist so geblieben, wie es war, außer der Kabelkanal an der Decke, weil die Lampe einfach an den falschen Platz geplant worden war.
Die Fenster gehen zur Straße raus. Man sieht den kleinen Vorgarten, den viel zu niedrigen Gartenzaun, die Straße, auf der eine Handvoll Autos parkt und die Häuser der Nachbarn. Alle ungefähr gleich alt. Wie deren Bewohner.
Er parkt das Cabrio gleich neben der Villa. Sie steht auf der großen Dachterrasse und winkt ihm zu. Ihre Bewegungen wirken etwas steif, aber so ist das, wenn man so wie sie etwas ungelenk ist. Mit dem hauseigenen Lift fährt sie ihm entgegen und will von ihm umarmt werden, doch seit einem Unfall und einer misslungenen Operation kann er seinen rechten Arm nicht mehr bewegen und sie stehen sich deshalb nur kurz gegenüber und schauen sich an, ohne mit Wimpern zu zucken. Ich kann mich nicht erinnern, ob Barbiepuppen überhaupt Wimpern haben? Ich kann auch nicht mehr nachschauen. 20 Euro für sie und ihn, die Villa samt Möbel, das Cabrio. Nur der Aufzug funktioniert nicht mehr. Das Seilchen ist irgendwann gerissen und Papa kann leider Aufzug-Seilchen genauso schlecht zusammenstückeln wie Barbiepuppenarme.
Zwei Wände sind Außenwände. Im Zimmer ist es deshalb immer ein bisschen kalt. Es gibt keinen Kamin oder Schwedenofen. Nur ein Ungetüm an Heizkörper direkt unter dem Fenster, in dessen Rillen sich der Staub fängt.
Um 19:00 Uhr ist „Papa-Time“. Egal ist uns das nicht, aber wir nehmen es zur Kenntnis. Wir dürfen bleiben und zuhören – bloß nicht dazwischenreden und nicht herumwetzen. Die „Papa-Time“ dauert eine schwache Stunde, in der wir versuchen zu verstehen, was die Menschen im Fernseher Papa erzählen und in der wir uns fragen, warum das für ihn wichtig ist. Es ist doch egal, welche Bombe in Jugoslawien eingeschlagen hat, welche Minderheit in Amerika schikaniert wird oder wie viele Nachbarn in Not sind. Aber wir reden nicht dazwischen, wir hören einfach zu. Wir wetzen auch nicht herum. Erst als die Wetterwölkchen auf der Österreich-Karte zu sehen sind, wissen wir, dass die „Papa-Time“ gleich vorüber ist. Und wie das Wetter in den nächsten Tagen wird.
Die Wände des Zimmers sind nicht weiß, eher beige.
Der Teppich am Boden ist nicht blau, eher grau.
Und das Holz der Möbel ist gar kein echtes Holz.
Dieser Text ist im Workshop „Autobiographisches Schreiben“ von Erika Kronabitter entstanden.