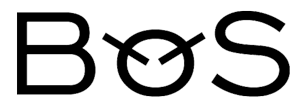Haushalt.
Ein Text von Miriam Unterthiner
Was hält sie in diesem Haus, das ihr keinen Halt gibt, das sie dennoch hält, in sich hält, damit es nicht zusammenfällt, auf ihr zusammenfällt – das Dach, die Wand, die Tür, das Fenster, der Blick nach außen – und sie in ihm drin, in diesem Haus, dessen Haushalt nur sie hält, sie hält es zusammen – die Kinder, den Mann, den ungedeckten Tisch.
Es gibt ihn nicht, diesen Haushalt, wo ist er denn, ja, wo soll er denn auch sein, wenn man ihn gar nicht sieht, wo sollte man ihn auch sehen, das kann man nämlich nicht, weil es ihn ja gar nicht gibt, diesen Haushalt, den angeblich nur sie hält; könnte man ihn sehen, dann wäre er da, da vor ihr, doch da vor ihr ist nichts, niemand ist da vor ihr, sie steht allein, vor diesen Trümmern steht sie allein und sucht nach Halt, den ihr dieser Haushalt nicht mehr gibt, niemals mehr geben wird, denn er ist nicht mehr da, kann man ihn doch nicht mehr sehen, kann ihn niemals mehr jemand sehen, selbst dann nicht, wenn sie ihn hält, denn da sieht man ja nicht hin, wer will da auch schon hinsehen, wenn sie den Haushalt hält, ist er doch gar nicht da, er ist bei der Arbeit.
Da ist er vollends da. Da kann man ihn auch sehen. Da kann jeder sehen, dass ihn nichts in diesem Haus mehr hält. Dass er sie dort nicht mehr hält. Im Haushalt. Dem seinen. Den sie für ihn hält. Die Hausfrau für den Hausmann, der kein Hausmann mehr ist, nur noch Ehemann, vielleicht nicht mal mehr Ehemann, vielleicht nur noch da, vielleicht nur noch Mann, in diesem Haus, dessen Hausmann er ist, ohne es zu sein.
Und so fällt er auseinander, fällt und fällt auseinander, dieser Haushalt, an dem sie sich noch immer hält, sich an ihm festhält, während er sie fallen lässt, dieser Haushalt, in dem gar nichts mehr hält, nicht mal mehr sie.