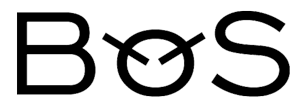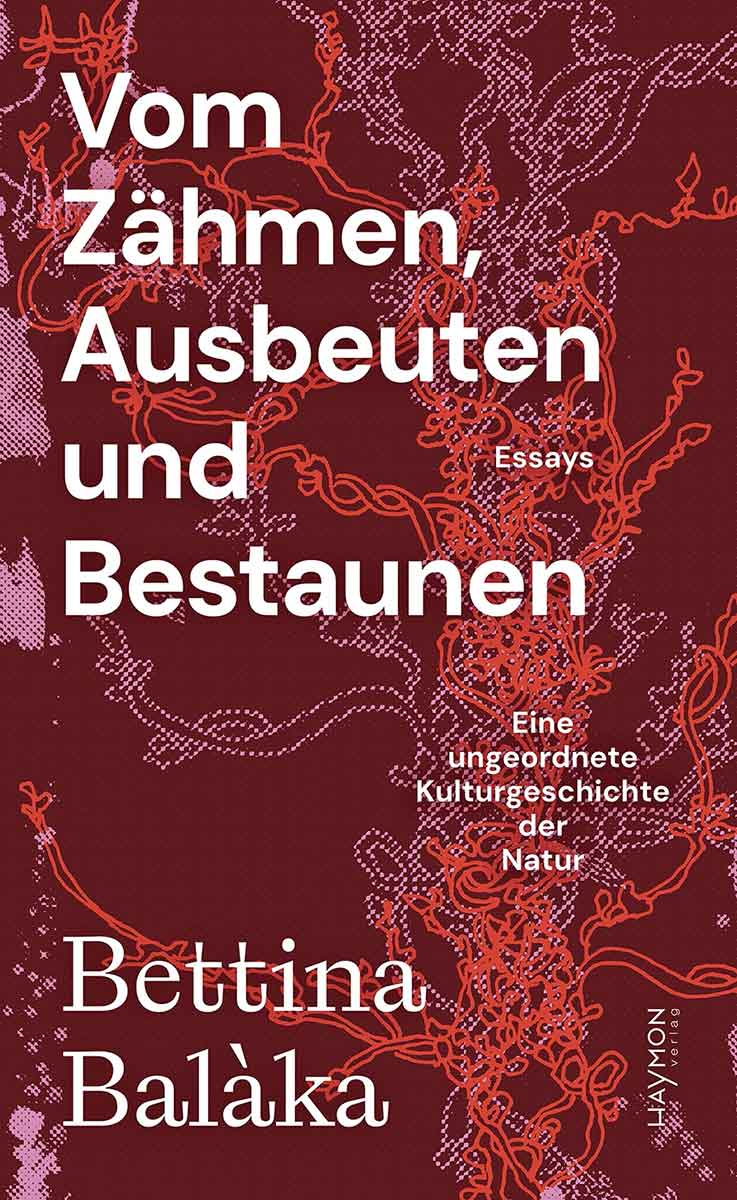Vom Zähmen, Ausbeuten und Bestaunen. Essays. Eine ungeordnete Kulturgeschichte der Natur – Bettina Balàka
Eine Rezension von Barbara Rieger
Bettina Balàka ist nicht nur eine produktive, sondern auch eine vielseitige Autorin: Alleine im Haymon Verlag erschienen zuletzt der Roman „Der Zauberer vom Cobenzl“ (2023), eine Gedicht-und Kurzprosasammlung „Die glücklichen Kinder der Gegenwart“ (2024) und der vorliegende Essayband. In diesem setzt Balàka sich in zehn unterschiedlich langen Essays mit unserem Verhältnis zur Natur auseinander.
Schon im ersten kurzen Beitrag „Zoobesuch mit Kinderschnitzel“ erklärt sie anschaulich die kognitive Dissonanz, die unser (gegenwärtiges, westliches!) Verhältnis zur Natur prägt: „Kognitive Dissonanz entsteht bei nicht miteinander zu vereinbarenden Haltungen und Handlungen. Man will nicht, dass Tiere leiden, will aber trotzdem Fleisch essen. Dieser psychologische Konflikt löst unangenehme Gefühle aus, man versucht ihn mit allen Mitteln zu vermeiden. Niemand könnte sich noch amüsieren, wenn das Schreckliche sichtbar würde.“ (S. 17f)
Und doch gelingt es der Autorin im vorliegenden Band auf wundersame Weise trotz der Schrecklichkeiten, die sie uns gut sichtbar serviert, einen Rest Amüsement zu bewahren. Es ist nicht (nur) der Spaß daran, den Finger in die Wunde zu legen oder gelegt zu bekommen oder der Genuss an der zielsicheren Handhabung des Skalpells der Sprache. Vielleicht ist es eine gewisse Freude an der (Selbst-)Erkenntnis?
Im längsten, härtesten und für mich zentralen Essay „Nicht Fisch, nicht Fleisch: Wenn Bewusstmachung die Geschmacksnerven verändert“ erzählt die Autorin, dass sie Fleisch liebte und das, obwohl sie schon als Jugendliche im Hühnerstall mitarbeitete. „In meinem Kopf gelang es mir, eine Mauer einzuschieben zwischen dem Anblick im Hühnerstall und dem Anblick auf meinem Teller, so wie man es eben machen musste, wenn man satt werden wollte.“ (S. 89) Das Unbehagen stellte sich schleichend ein. Persönlicher Kontakt mit den Turopolje-Schweinen bei einer Feier auf einem Weingut: „Bevor man das Fleisch aß, konnte man sich vergewissern, dass es ihnen gut ging. Ich vergewisserte mich, dass es ihnen gut ging, und konnte sie nicht mehr essen.“ (S. 74). Die Begegnung mit einer kommunikativen Sepia während eines Tauchgangs und schließlich der Dokumentarfilm „The End of Meat“. Bettina Balàka wurde zur Vegetarierin und obwohl sie andere nicht direkt überzeugen möchte, es ihr gleichzutun, führt sie uns vor Augen: „Das Nahrungsmittel Fleisch ist tief verwurzelt in unserer Geschichte und Kultur“ (S.85), unser heutiger Umgang damit ist – ich, die Rezensentin kann nicht anders, als es hier so polemisch zusammenzufassen – schlichtweg krank.
Und als Ansatz für einen anderen Umgang – in den Worten der Autorin, die es auf den Punkt bringen: „Hühner haben Gefühle. Menschen auch.“ (S.91)
In einem weiteren Beitrag mit dem Titel „In andere Häute schlüpfen: Empathie in der Literatur“ analysiert Balàka literarische Auseinandersetzung mit Tieren, wie z.B. „The Terrapin“ von Patricia Highsmith, „Die Spitzin“ von Marie von Ebner-Eschenbach oder „Black Beauty“ von Anna Sewell, und zeigt unterschiedliche Möglichkeiten des Unverständnisses, der Grausamkeit und der Einsicht auf.
Im längeren Essay „Kraut und Unkraut: Vom Anbauen und Verbauen“ verwebt sie subjektive Erfahrungen mit historischen Informationen, wissenschaftliche Erkenntnisse mit Glaubenssätzen unserer kapitalistischen Gesellschaft und weist uns als Draufgabe mittels literarischer Beispiele auf die Gleichsetzung des Weiblichen mit der Natur hin. Eines ist jedenfalls – ganz unpolemisch – klar: Der gesellschaftliche Umgang mit Natur ist nicht nur paradox, sondern in höchstem Maß destruktiv.
Als „ambivalent“ bezeichnet Balàka das Verhältnis des Menschen zur Natur im Vorwort. Mit „toxic relationship“ wirbt der Klappentext. Während ersteres mir nach der Lektüre fast als beschönigend erscheint, ist zweiteres irreführend, legt es doch nahe, dass „die Natur“ die Beziehung zum Menschen verlassen oder auflösen könnte. Doch kann sie das? Findet das Leben, wie im berühmten Film „Jurassic Park“ (1993) gesagt wird, immer einen Weg? Wollen wir es hoffen?
In diesem Jahr hält die Autorin drei Workshop beim BÖS (Hier der Link zum zeitnähesten: https://www.bös.at/schreibworkshops/stilistik-feinheiten-und-feinschliff/). Als Unterrichtende ist sie übrigens ebenso hervorragend.
Barbara Rieger, März 2025
Für die Rezensionen sind die jeweiligen VerfasserInnen verantwortlich.
Bettina Balàka: Vom Zähmen, Ausbeuten und Bestaunen. Essays. Ein ungeordnete Kulturgeschichte der Natur
Innsbruck: Haymon Verlag 2024
2013 Seiten
22,90 EUR
ISBN 978–3‑7099–7039‑3
Mehr zum Verlag
Mehr zum Buch
Mehr zur Autorin
Mehr zur Rezensentin